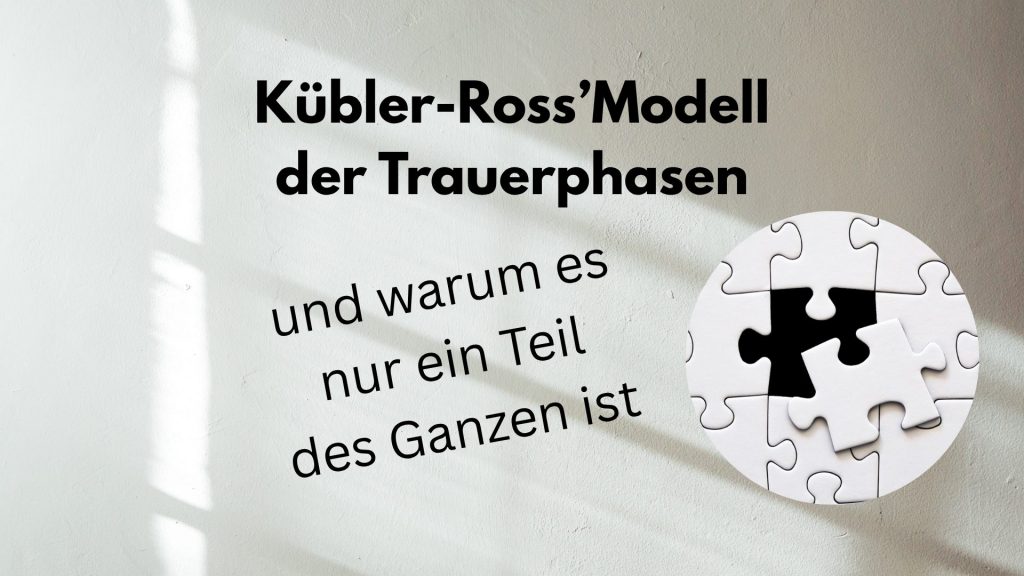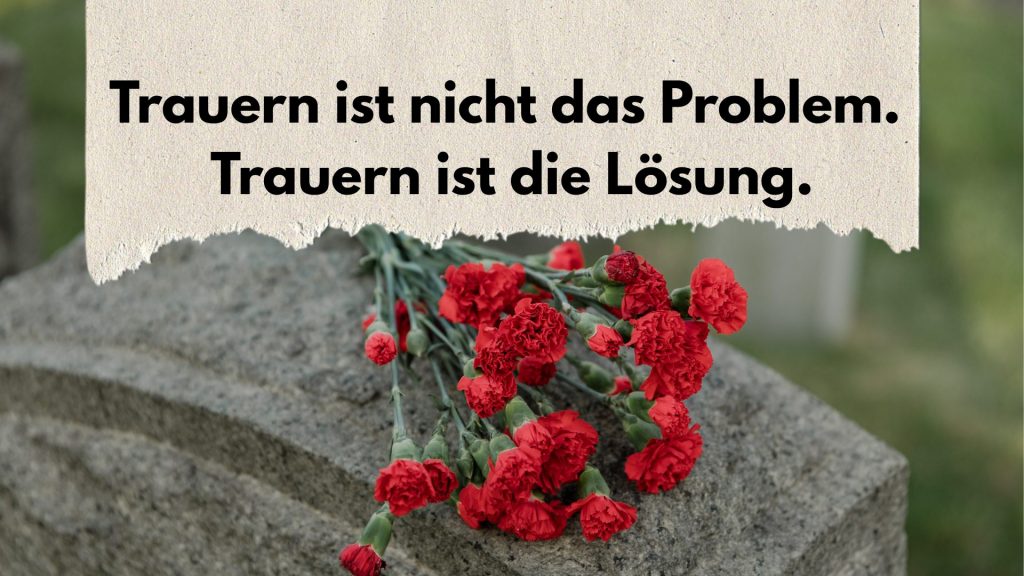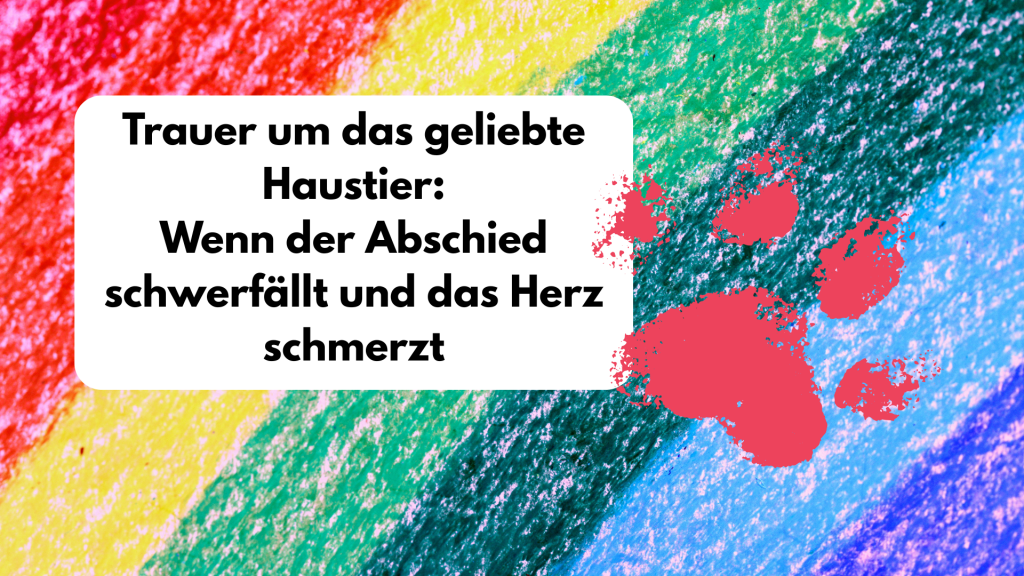Von Trauer zur inneren Stärke – warum Loslassen manchmal der Anfang ist
Es gibt Momente, da fühlt sich das Leben an, als würdest du einfach nur noch weitermachen.Du stehst morgens auf, machst Frühstück, kümmerst dich um die Kinder, gehst arbeiten, organisierst, trägst, planst, hältst alles am Laufen und am Abend bleibt kaum etwas von dir selbst übrig. Vielleicht kennst du dieses Gefühl, innerlich leer zu sein, obwohl du eigentlich „alles hast“.Du liebst deine Familie, dein Zuhause, deinen Alltag und trotzdem fehlt etwas.Etwas, das du nicht greifen kannst, aber spürst: Ruhe. Leichtigkeit. Du. Viele Frauen erzählen mir, dass sie sich manchmal gar nicht mehr erinnern können, wann sie das letzte Mal einfach durchgeatmet haben.Ohne schlechtes Gewissen. Ohne To-do-Liste im Kopf. Ohne das Gefühl, versagen zu müssen, wenn sie einfach nur da sind. In diesem Artikel geht es um genau diesen Punkt. Darum, warum wir uns selbst so oft verlieren und wie du Schritt für Schritt wieder zu dir zurückfinden kannst.Darum, was Loslassen wirklich bedeutet, und warum es kein Zeichen von Schwäche ist, sondern ein stiller Beginn von innerer Stärke. Wenn du spürst, dass du bereit bist, dir selbst wieder näher zu kommen, dann lies weiter. Das hier ist für dich. Falls du merkst, dass ist nicht ausreichend, lade ich dich herzlich zu einen kostenlosen Kennenlernen ein. Kontaktiere mich dafür über das Kontaktformular. Ein stiller Anfang Ich habe viele Menschen in ihrer Trauer begleitet.Ich habe gesehen, wie viel Kraft in Schmerz steckt, wenn man ihn verstehen darf.Aber irgendwann habe ich gespürt: Es ist Zeit, den Blick weiterzufächern, da immer mehr Mütter zu mir gekommen sind. Ich bin selbst Mutter, Ehefrau, Tochter und Enkelin, ich weiß wie herausfordernd manche Situationen sein können. Zudem leite ich ehrenamtlich eine Mutter-Kind-Gruppe, was auch nochmal meinen Fokus mehr auf die Mama Beratung gelenkt hat. Ich habe bereits zwei Artikel zum Familienleben in der familiii veröffentlicht: Die Familie: der sichere Hafen und Entspannte Eltern, entspanntes Baby. Die Trauerarbeit ist mein Herzenprojekt und wird immer bleiben, denn Trauer zeigt sich nicht nur, wenn wir einen Menschen verlieren.Sie kann auch da sein, wenn wir uns selbst verloren haben, zwischen Erwartungen, Familie, Arbeit und all den To-dos, die sich jeden Tag stapeln.Wenn du das Gefühl hast, nur noch zu funktionieren, dann trauerst du vielleicht um etwas, das du kaum benennen kannst: deine Leichtigkeit, deine Ruhe, dein Ich. Genau da beginnt die Veränderung. Nicht laut, nicht perfekt. Sondern leise, ehrlich und mitten im Alltag. Wenn das Leben zu viel wird Ich sehe viele Frauen, die ihren Alltag mit beeindruckender Stärke tragen. Sie stehen morgens auf, bevor der Rest der Familie wach ist. Bereiten Frühstück vor, bringen Kinder zur Schule, arbeiten im Job, organisieren Termine, kümmern sich um Eltern, Freunde, Partner. Und wenn endlich Ruhe einkehrt, spüren sie: Da ist kaum noch etwas übrig für mich. Vielleicht kennst du das auch – dieses ständige Gefühl, „funktionieren“ zu müssen. Du willst alles richtig machen, niemanden enttäuschen, für alle da sein. Und dabei verschwindest du selbst Stück für Stück aus deinem eigenen Leben. Viele Mütter, mit denen ich arbeite, sagen Sätze wie: „Ich will einfach mal wieder durchatmen.“, „Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.“ Oder:„Ich mache alles, aber ich fühle nichts mehr.“ Das sind keine Zeichen von Schwäche. Das sind Signale deiner Seele, dass du zu lange durchgehalten hast. Und dass es Zeit ist, etwas zu verändern. Was Loslassen wirklich bedeutet Loslassen hat für viele einen bitteren Beigeschmack. Es klingt nach Aufgabe, nach Scheitern, nach Kontrolle verlieren. Doch Loslassen ist das Gegenteil davon. Loslassen heißt, Platz zu schaffen. Platz für das, was jetzt wichtig ist. Für dich. Für das, was dir guttut. Für ein Leben, das sich leichter anfühlt. Manchmal bedeutet Loslassen, eine Rolle nicht mehr perfekt erfüllen zu wollen. Manchmal heißt es, nicht mehr jedem gerecht zu werden. Oder endlich aufzuhören, dich über deine Leistung zu definieren. Loslassen ist kein Ende. Es ist ein Übergang. Ein Schritt in ein Leben, in dem du wieder atmen darfst. Trauer im Alltag oder auch der Abschied vom alten Ich Viele denken bei Trauer an den Verlust eines geliebten Menschen. Aber Trauer kann auch etwas viel Alltäglicheres sein: der stille Abschied von dem, was einmal war. Von der Frau, die du warst, bevor du Mutter wurdest. Von dem Gefühl, frei zu entscheiden, was du willst. Oder von der Energie, die du hattest, bevor alles zu viel wurde. Wenn du spürst, dass du innerlich leer bist, dann ist das oft ein Zeichen für inneren Abschied. Du trauerst um das „alte Ich“, das spontan war, neugierig, lebendig. Und genau in diesem Gefühl steckt die Chance für einen Neuanfang. Denn du darfst dich neu entdecken. Das durfte ich in meiner Trauer auch. Nicht so, wie du früher warst, sondern so, wie du heute bist.Mit deiner Erfahrung, deiner Stärke und deinem Wunsch nach Ruhe. Warum Mama Beratung helfen kann Viele Mütter wünschen sich eine Pause, aber kaum jemand zeigt ihnen, wie das geht. Mama Beratung setzt genau hier an: Es ist kein weiterer Ratgeber, der dir sagt, was du tun musst. Es ist ein Raum, in dem du wieder spüren darfst. Im Mama Beratung geht es nicht darum, alles perfekt zu machen. Sondern darum, dich selbst wieder wahrzunehmen. Deine Bedürfnisse. Deine Grenzen. Deinen Rhythmus. Gemeinsam schauen wir, was dich überfordert, wo du dich selbst verlierst und wie du Schritt für Schritt zu mehr innerer Ruhe findest.Das ist kein schneller Prozess, aber ein echter. Du lernst, wie du mit Stress anders umgehen kannst, wie du dich inmitten des Alltags zentrierst und wie du dir selbst wieder vertrauen kannst. Nicht, weil du musst, sondern weil du darfst. Selbstfürsorge für Mütter – warum sie kein Luxus ist Selbstfürsorge wird oft missverstanden. Viele denken, es gehe um Wellness, um Me-Time oder um kleine Pausen. Aber wahre Selbstfürsorge beginnt viel tiefer. Selbstfürsorge heißt, dich ernst zu nehmen. Deine Gefühle. Deine Grenzen. Deine Bedürfnisse. Es bedeutet, dich selbst so zu behandeln, wie du dein Kind behandeln würdest, mit Verständnis, Geduld und Liebe. Wenn du immer nur gibst, ohne zu nehmen, entsteht ein Ungleichgewicht. Du kannst nicht aus einem leeren Becher schenken. Selbstfürsorge ist kein Egoismus. Sie ist
Von Trauer zur inneren Stärke – warum Loslassen manchmal der Anfang ist Weiterlesen »